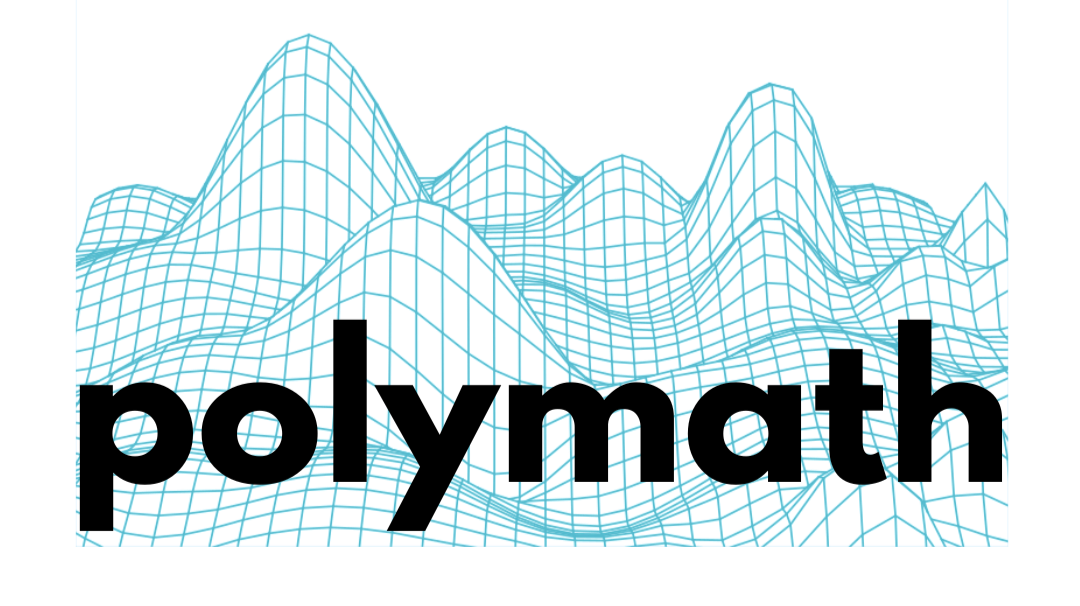Pumpspeicherkraftwerk
Dient primär als Energiespeicher und nicht nur zur direkten Stromerzeugung:
-
Bei Energieüberschuss (z. B. aus Wind- oder Solarstrom) wird Wasser mit Pumpen vom unteren in das obere Becken befördert.
-
Bei Energiebedarf wird das Wasser wieder nach unten abgelassen, wodurch es eine Turbine antreibt und Strom erzeugt.
Nutzung bestehender Infrastruktur
-
Bergwerke verfügen bereits über tiefe Schächte und Stollen, die als Wasserspeicher oder Druckrohrleitungen genutzt werden können.
-
Dies reduziert die Baukosten im Vergleich zum Bau neuer Speicherbecken in der freien Natur
Großer Höhenunterschied
-
Der Höhenunterschied zwischen einem Ober- und Unterbecken bestimmt die Energieerzeugung.
-
In ehemaligen Bergwerken gibt es bereits tiefgelegene Bereiche, die als Unterbecken dienen können.
-
Das erleichtert die Konstruktion und erhöht die Energieausbeute.
Geringer Landschaftseingriff
-
Klassische Pumpspeicherwerke benötigen große Stauseen, die oft Flächen verbrauchen und ökologisch umstritten sind.
-
In Bergwerken bleibt die Technik unterirdisch, was die Landschaft schont und Genehmigungen erleichtert.
Hohe Effizienz
80 % Wirkungsgrad
Hohe Lebensdauer
mind. 80 Jahre
Klimaneutral
Keine direkten Emissionen
Ressourcenschonend
Keine Batteriematerialien wie Lithium oder Kobalt
Gravitationsspeicher mit Betongewichten
Dient primär als Energiespeicher und nicht zur direkten Stromerzeugung:
-
Bei Energieüberschuss (z. B. aus Wind- oder Solarstrom) werden schwere Betonblöcke mithilfe elektrischer Energie angehoben.
-
Bei Energiebedarf werden die Gewichte kontrolliert abgesenkt – dabei treiben sie Generatoren an und erzeugen so Strom.
Nutzung bestehender Infrastruktur
-
Stillgelegte Industrieanlagen oder Bergwerke bieten bereits geeignete vertikale Schächte oder Flächen für Turm- und Kransysteme.
-
Diese können für das Heben und Senken der Betonmassen genutzt werden – das spart Baukosten im Vergleich zum Neubau großer Anlagen in unerschlossenem Gelände.
Großer Höhenunterschied (großes Gefälle)
Die Energiemenge hängt von der Fallhöhe der Betongewichte ab.
Ehemalige Bergwerke oder hohe Kransysteme ermöglichen große Höhenunterschiede, die eine besonders effiziente Energiespeicherung und -rückgewinnung ermöglichen.
Geringer Landschaftseingriff
-
Im Gegensatz zu klassischen Pumpspeicherwerken sind keine großen Stauseen notwendig.
-
Gravitationsspeicher mit Betonblöcken benötigen vergleichsweise wenig Fläche und können oft in bestehende Industrieumgebungen integriert werden – das minimiert Umwelteingriffe und erleichtert Genehmigungen.
Hohe Effizienz
80 % Wirkungsgrad
Hohe Lebensdauer
mind. 80 Jahre
Klimaneutral
Keine direkten Emissionen
Ressourcenschonend
Keine Batteriematerialien wie Lithium oder Kobalt

Speicherkraftwerke
Entwicklung
Einsatzmöglichkeiten
Die Nutzung alter Bergwerksstollen für Pumpspeicherkraftwerke ist eine clevere Kombination aus Nachhaltigkeit, Kostenersparnis und Effizienz. Sie hilft, erneuerbare Energien besser ins Netz zu integrieren und gibt stillgelegten Bergwerken eine neue Funktion.
Bergwerke verfügen bereits über tiefe Schächte und Stollen, die als Wasserspeicher oder Druckrohrleitungen genutzt werden können.
Dies reduziert die Baukosten im Vergleich zum Bau neuer Speicherbecken in der freien Natur

© Roberto Schirdewahn